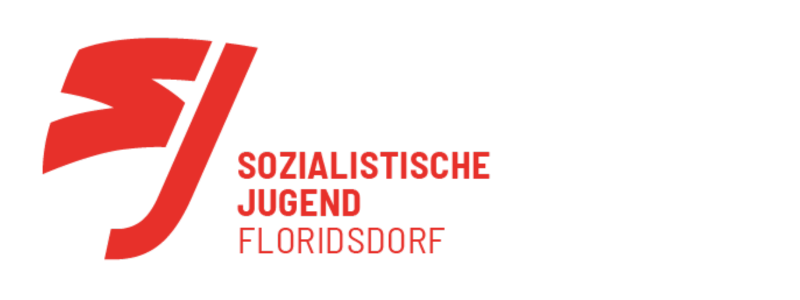Das Sonderkommando des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau war ein besonderes Arbeitskommando, das aus jüdischen männlichen Häftlingen bestand.
Die Anzahl der Männer in diesem Kommando variierte stark. Während es im Mai 1944 ca. 900 Sonderkommando-Häftlinge waren, reduzierte sich die Zahl im Oktober auf 100 Mann. Insgesamt wird die Zahl dieser Häftlinge auf ca. 2.200 geschätzt.
Dieses Arbeitskommando erledigte die so genannte „Drecksarbeit“ im Konzentrationslager, für die sich die SS- Leute zu schade waren. Gideon Greif schreibt z.B. in seinem Buch „Wir weinten tränenlos…“: „Andererseits ist verbürgt, dass nicht alle SS-Angehörigen die Massenvernichtung als tägliche Aufgabe gerne hinnahmen; das Delegieren eines Teils der Arbeit, und zwar des schmutzigsten, an die Opfer selber sollte helfen (und wahrscheinlich half es auch), manches Gewissen zu erleichtern.“
Das Sonderkommando unterlag den Befehlen der SS und musste ihnen im „Vernichtungsprozess“ helfen. Wenn neue Häftlinge in das Konzentrationslager eingetroffen sind, dann wurden sie nach der Selektion entweder zum Arbeiten in die Baracken oder direkt zu den Gaskammern geschickt. Die Aufgabe des Sonderkommandos war es, diese „Neuankömmlinge“ zu beruhigen, ihnen zu erklären, dass sie nur duschen gehen würden und ihnen beim Ausziehen zu helfen. Es kam nicht selten vor das ein Häftling des Sonderkommandos ein eigenes Familienmitglied darauf vorbereiten musste in den Tod zu gehen.
Nach dem qualvollen Gastod der Deportierten wurden die Leichen, wie man im Nazijargon sagt ,,verwertet”. Das bedeutet, dass das Sonderkommando die Leichen nach Wertgegenständen durchsuchen musste und ihnen die Goldzähne hinauszogen. Den weiblichen Leichen wurde der Kopf kahlgeschoren. Diese Haare wurden dann als Zünder in Granaten, zur Teppichherstellung, etc. verwendet.
Nach dieser Prozedur musste das Sonderkommando die Leichen zu den Krematorien transportieren und sie verbrennen.
Die Arbeit im Sonderkommando hat sich enorm auf die Psyche ausgewirkt. Die Häftlinge stumpften immer mehr ab. Viele, meist Neulinge im Sonderkommando begingen Selbstmord in dem sie freiwillig in eine Gaskammer gingen, sich gegen den Elektrozaun warfen oder sich von der SS erschossen ließen.
Die Nazis nutzen aber auch die Funktionen und Aufgaben des „Sonderkommandos“ für ihre Propagandazwecke. Denn „Juden mussten es sein, die die Juden in die Verbrennungsöfen transportierten, man musste beweisen, dass die Juden, die minderwertige Rasse, die Untermenschen, sich jede Demütigung gefallen ließen und sich sogar gegenseitig umbrachten.“[2]
Dass die Juden (angeblich ohne Gewissensbisse) ihre eigenen Leute umbrachte war der Beweis für die Nazis, dass es sich um eine unzivilisierte „Unterrasse“ handeln müsse. Denn wie konnte man sonst sein eigenes Volk vernichten?
Grundsätzlich war das „Sonderkommando“ von den anderen Lagerhäftlingen völlig isoliert, d.h. sie konnten auch niemandem von ihren Tätigkeiten erzählen. Viele fertigten jedoch Tagebücher an, wo sie alle Erfahrungen genau dokumentierten. Diese Tagebücher wurden dann auf dem Lagergelände versteckt und nach der Befreiung erst gefunden.
Wenn Sonderkommando-Häftlinge versuchten, die Flucht zu ergreifen und erwischt wurden, dann wurden sie noch härter bestraft als die übrigen Lagerinsassen. Bei einer Flucht hatte eine ganze Baracke mit Bestrafung zu rechnen. Die Bestrafungen sahen immer unterschiedlich aus. Häufig wurde man mit dem Hungertod im Bunker bestraft, oft wurden aber auch Familienangehörige ins Lager deportiert und zur Abschreckung auf den Galgen ausgestellt.
1944, im letzten Jahr des Bestehens des Konzentrationslagers kam es zu einem bewaffneten Aufstand durch die Häftlinge des Sonderkommandos in den Krematorien III/IV. Die Männer wurden bei diesen Gaskammersprengungen von den weiblichen Häftlingen unterstützt, die Sprengstoff aus einer Waffenfabrik einschmuggelten. Das Krematorium IV wurde damit fast vollständig zerstört.
Die Gefangenen unternahmen eine Massenflucht, aber alle 250 beteiligten Häftlinge wurden von der SS gefasst und ermordet.
In regelmäßigen Abständen wurden die Häftlinge des Sonderkommandos von der SS liquidiert, um die Gefahr von Zeugenaussagen über die stattgefundenen Gräueltaten zu vermeiden. Trotzdem gelang es einigen Häftlingen zu überleben. Sie mischten sich bei der Evakuierung des Lagers unter die übrigen Häftlinge und flohen auf dem Todesmarsch. Die Aussagen der Überlebenden erwiesen sich als besonders hilfreich um Menschenverbrechen aufzudecken und die Verantwortlichen zu fassen.
„Wir weinten tränenlos…“:
Ein sehr bedeutendes Werk in diesem Zusammenhang ist Gideon Greif’s „Wir weinten tränenlos…“.
Das Buch des israelischen Historikers sorgte bei seinem Erscheinen 1995 für viel Gesprächsstoff und Kritik. Greif hat sieben Überlebende des „Sonderkommandos“ von Auschwitz- Birkenau interviewt, um auf dieser Art und Weise alle Details der schrecklichen Arbeit zu erfahren. Die interviewten Männer rekonstruieren in dem Buch ihren Arbeitsalltag im Konzentrationslager, beschreiben, wie sie mit der Situation umgegangen sind und schildern, welchen Reaktionen sie ausgesetzt waren nach der Befreiung aus Auschwitz- Birkenau.
Manche von den Überlebenden sprachen das erste Mal über ihre Funktion im Vernichtungslager. Nicht einmal ihre Familien und engsten Freunde wussten, welche Rolle sie im Vernichtungsprozess der Deutschen gespielt hatten.
„Wir weinten tränenlos…“ ist in zweifacher Hinsicht besonders: einerseits ist das Werk fundamental für die Geschichtsaufarbeitung. Die lange verschwiegene Existenz bzw. Nichtbeachtung von „Sonderkommandos“ wurde dadurch beendet.
Es kam eine Tatsache ans Licht, die neue Dimensionen der Massenvernichtung aufzeigte. Außerdem straft das Buch durch die ausführlichen und realitätsgetreuen Schilderungen der Überlebenden all diejenigen Lügen, die die Existenz von Konzentrationslagern bis heute leugnen bzw. die Vorkommnisse in Auschwitz-Birkenau relativieren.
Andererseits waren auch die Reaktionen zu diesem Werk sehr interessant und vielschichtig. Viele gaben den „Sonderkommando“- Häftlingen die Mitschuld für den millionenfachen Tod der eigenen Leute. Dieses gesellschaftliche Echo führte dazu, dass sich viele andere Überlebenden aus Schamgefühl und Angst vor der gesellschaftlichen Missachtung nicht trauten, über ihre Erfahrungen im „Sonderkommando“ zu sprechen.
Einige Beanstandungen kamen auch von anderen „Sonderkommando“- Überlebenden, die im Buch nicht zu Wort gekommen sind. Sie kritisierten u.a. die viel zu detaillierte und somit für die Gesellschaft nicht zumutbare Darstellung ihrer Arbeit und generell das Wiederauflebenlassen dieser bereits verdrängten Zeit ihres Lebens.
Natürlich gab es auch positive Rückmeldungen. Durch diese Interviews wurden andere Überlebende ermutigt, über ihre Tätigkeiten im Konzentrationslager zu berichten. Des Weiteren nahm man sich gesellschaftlich und wissenschaftlich dieses lange ignorierten Themas an.
Außerdem dankten viele Organisationen und Institutionen (wie. z.B. Schulen in Israel, religiöse Einrichtungen,…) Gideon Greif und den befragten Überlebenden für ihren Mut zur Ehrlichkeit.
[1] Greif, Gideon (2011): Wir weinten tränenlos… Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt a.M., S. 28
[2] Ebd.